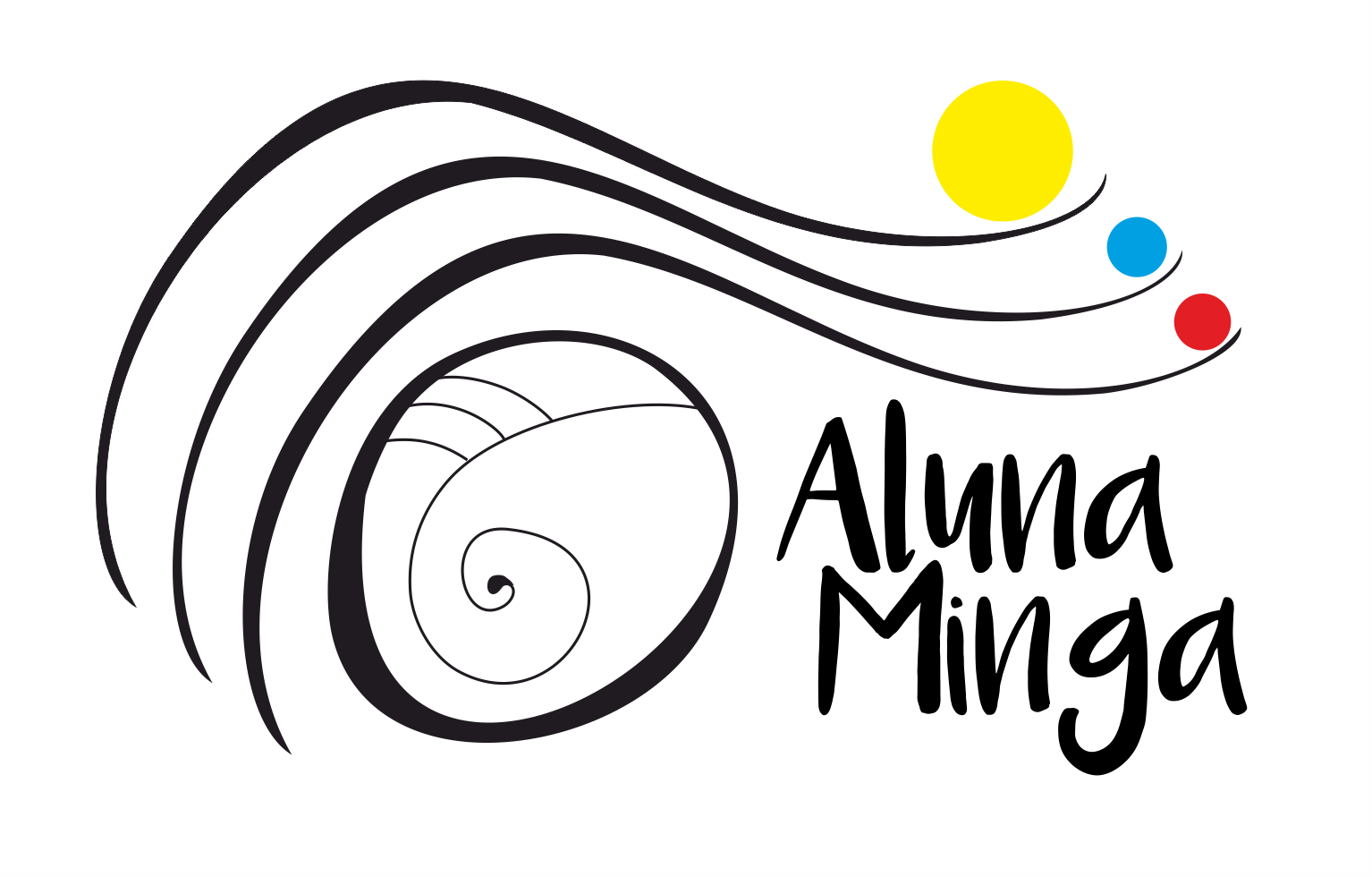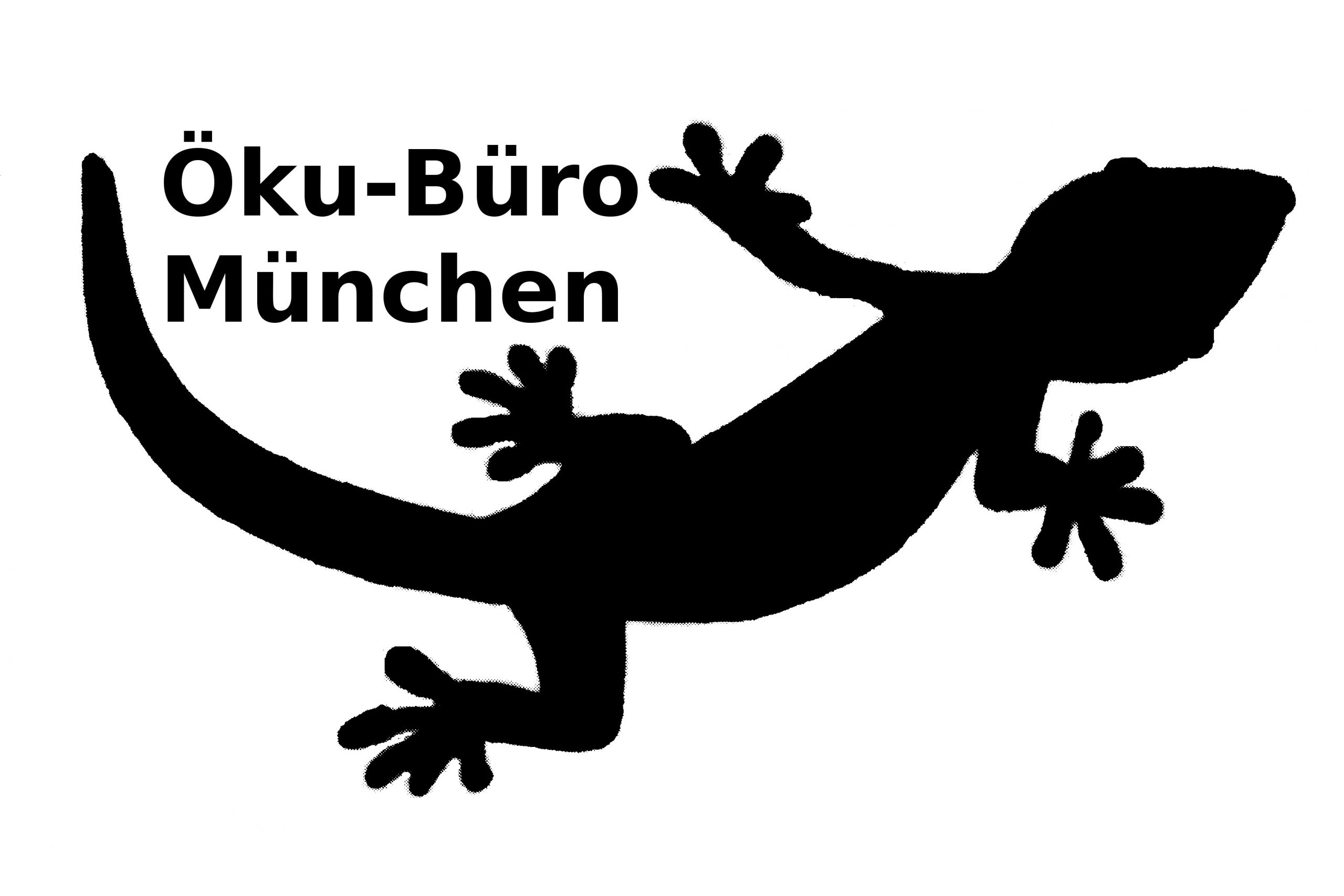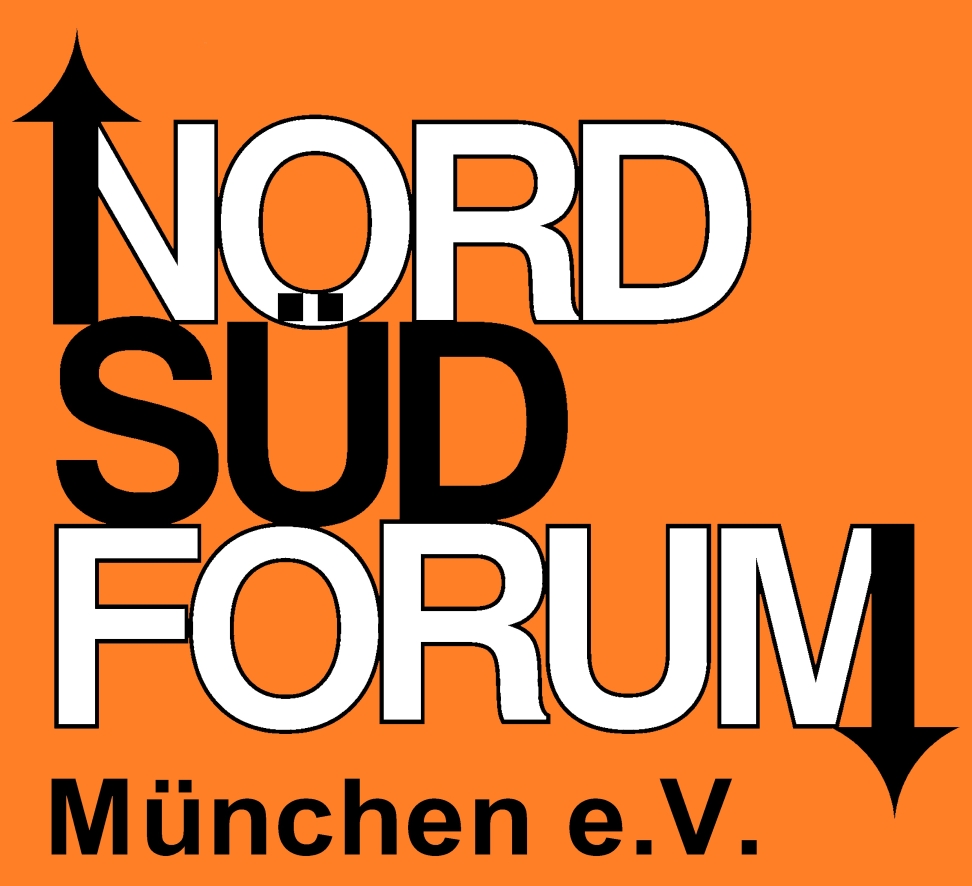|
|
Ein paradoxes Versprechen: Legitimation und Institutionalisierung des „Rechts“ auf Umweltzerstörung durch CO2-Emissionszertifikate
Kontakt
A palavra viva é diálogo existencial. Expressa e elabora o mundo, em comunicação e colaboração. O diálogo autêntico – reconhecimento do outro e reconhecimento de si, no outro – é decisão e compromisso de colaborar na construção do mundo comum.
- Paulo Freire
Das lebendige Wort ist existentieller Dialog. Es drückt die Welt aus und gestaltet sie in Kommunikation und Zusammenarbeit. Der authentische Dialog – die Anerkennung des Anderen und die Selbsterkennung im Anderen – ist Entscheidung und Verpflichtung, am Aufbau der gemeinsamen Welt mitzuwirken.
- Paulo Freire

Im kolumbianischen Amazonasgebiet, zwischen den Flüssen Guaviare und Inirida, lebten die Nukak Makú traditionell zurückgezogen und mieden den Kontakt mit Siedlern aus anderen Regionen Kolumbiens.1 Diese Lebensweise wurde jedoch durch die Invasion ihrer angestammten Gebiete durch Siedler:innen, bewaffnete Auseinandersetzungen und die gewaltsame Vertreibung zerstört.2 Diese Gewalt, als unmittelbare Fortsetzung kolonialer Gebietskontrolle, hat die sozialen und ökonomischen Grundlagen der indigenen Völker im Amazonas zerrüttet und die ökologische Integrität der Region fragmentiert. Aber solche Missachtung indigener Lebensweisen ist strukturell verankert – über die großflächige Abholzung des Regenwaldes für Viehzucht, Rohstoffabbau und Koka-Anbau bis zur damit einhergehenden Präsenz bewaffneter illegaler Gruppen. Außerdem, wie bereits zur Zeit der massiven europäischen Invasion Ende des 15. Jahrhunderts, führen auch heute noch Epidemien, die durch den Kontakt mit Siedler:innen eingeschleppt wurden, zu Todesfällen unter den Nukak Makú. Dies hat zu einem drastischen Bevölkerungsrückgang geführt.3
Eine journalistische Recherche wurde im Oktober 2025 veröffentlicht: „Nukak: Vertrieben und nun in einem zwielichtigen Geschäft mit Emissionszertifikaten missbraucht.“4 Die Recherche zeigt, wie in den letzten Jahren ein Netzwerk aus Politiker:innen und Unternehmer:innen öffentliche Aufträge im Zusammenhang mit der Gemeinschaft der Nukak kontrolliert und versucht hat, Einfluss auf ein Geschäft mit Emissionszertifikaten zu nehmen, wobei es zu Morddrohungen und in der Folge zu Gerichtsverfahren kam.5
Die Hauptakteure sind auf der einen Seite ein Netzwerk aus lokalen Politiker:innen und Unternehmer:innen, angeführt von Jeison Benachi (Gründer von Innova Green/Corpogreen und Politiker) und Shirley Ortiz (sie war 2019 Kandidatin für das Bürgermeisteramt von Miraflores, the place where peace never arrived6), und auf der anderen Seite die Gemeinschaft des indigenen Volkes Nukak im Departement Guaviare, das als „letztes nomadisches Volk“ Kolumbiens gilt und vom Aussterben bedroht ist. Der zentrale Vorwurf ist die Ausnutzung der prekären Lage und rechtlichen Vertretung durch den abubaka (Anführer) der Nukak, um undurchsichtige Verträge über Kohlenstoffzertifikate für ihr 954.000 Hektar großes Reservatsgebiet zu schließen. Es handelt sich um einen Gebiet so groß wie die Hälfte des ganzen bayrischen Waldes.
Angesichts der geringen und schwachen Präsenz des Staates, da es sich um ein Gebiet handelt, das unter zentralistischen Regierungen historisch marginalisiert war, ist das Gebiet massiver Entwaldung ausgesetzt und zudem Schauplatz von Konflikten zwischen bewaffneten Gruppen (u.a. Dissidenten der FARC-Guerilla, Viehzüchter, Drogenhändler, Minenbetreiber). Unbekannt ist es auch nicht, dass Vertreibungen, gerichtliche Verfahren, und Verlust strategischer Verbündeter (vor allem NGOs) der Nukak, so wie Eingriffe in deren Autonomie an der Tagesordnung sind.
Perverse Wohltaten
Während im Amazonas Regenwald sowohl die Lebensgrundlagen indigener Völker, als auch die einzigartige Biodiversität, durch Brände und ausgetrocknete Flüsse unwiederbringlich zerstört werden, basiert die internationale Klimapolitik auf einem System, das solche Zerstörung nicht nur nicht beendet, sondern sie zynisch verwaltet und kommerzialisiert. Diese brutale, aber politisch und ökonomisch einkalkulierte Dynamik trifft diejenigen am härtesten, die am wenigsten zur aktuellen Klimakrise beigetragen haben. Die verarmtesten Länder der Welt sind nachweislich am anfälligsten für Klimafolgen, was die grundlegende Ungerechtigkeit des aktuellen Systems unterstreicht. Im Folgenden möchte ich im Lichte einiger philosophischer Ansätze Paulo Freires analysieren, wie CO₂-Emissionszertifikate – einst als marktwirtschaftliche und umweltfreundliche Lösung gefeiert – durch lobbyistische Einflüsse mittlerweile in erster Linie zur Rechtfertigung umweltschädlicher Handlungsweisen dienen. Statt zu echter Transformation anzureizen, verlängert und legitimiert dieses System so die Zerstörung der empfindlichsten Ökosysteme des Amazonas und überhaupt unseres Planeten.
Die Perversität dieses Lösungsvorschlags aus der Ebene der globalen Marktwirtschaft ist nicht zu verbergen. Im Lichte einer freireanischen Analyse lassen sich die Kompensationsmechanismen als besonders perfide Form der „Großzügigkeit“ der Unterdrückenden bezeichnen. Indigene Gemeinschaften wie die Nukak werden nicht nur ihres Landes beraubt, sondern ihre prekäre Situation wird zusätzlich instrumentalisiert, um Profit und Verschmutzungsrechte für Industrien des Globalen Nordens zu generieren. Dies entspricht genau dem, was Freire als „falsche Großzügigkeit der Unterdrückenden“ (a falsa generosidade dos opressores) beschreibt7 - eine scheinbare Wohltat, die in Wirklichkeit die Abhängigkeitsverhältnisse zementiert und die Unterdrückten in ihrer Opferrolle gefangen hält. Die Logik hinter Praktiken wie Greenwashing und politisch legitimierten Formen des CO₂-Emissionshandels offenbart eine verblüffende Parallele zu Paulo Freires Konzept der unterdrückenden „Großzügigkeit“. In seiner „Pädagogik der Unterdrückten“ beschreibt er, wie herrschende Systeme ihre Macht nicht nur durch Zwang, sondern auch durch scheinbare Großzügigkeit stabilisieren – durch Zugeständnisse, die gerade umfangreich genug sind, um grundlegende soziale Veränderungen zu verhindern. In diesem Sinne kann Freires Einsicht die Problematik erhellen, dass die herrschende Klasse – in diesem Fall große Konzerne, deren Geschäftsmodelle auf der Ausbeutung von Natur und Menschen basieren – keine genuine transformative Kraft für die Überwindung der ökologischen Krise entwickeln kann. Ihre Macht gründet strukturell auf jenem ungerechten System, das sie vorgeben reformieren zu wollen.
Die „falsche Großzügigkeit“, übersetzt hier als ökonomische Kompensationen für die systematische Zerstörung der Lebenswelt, schafft einen Zyklus der Abhängigkeit unter den historisch benachteiligten, unterdrückten Völkern, anstatt ihre Selbstbestimmung zu ermöglichen. Sie lädt die Unterdrückten ein, innerhalb der von den Unterdrückenden gesetzten Grenzen nach „Lösungen“ zu suchen – wie etwa nach „fairen“ Preisen für ihre Kohlenstoffzertifikate oder nach „besseren“ bzw. profitableren Kompensationsprojekten. Damit wird der eigentliche Konflikt – die grundsätzliche Legitimität, die Atmosphäre als Müllkippe zu nutzen und damit Handel zu treiben – irgendwie elegant umgangen. Die radikale Forderung nach einem Ende der Verschmutzung wird so in eine technokratische Debatte über deren effiziente Verwaltung übersetzt. Diese Kompensation ist somit keine Geste der Versöhnung, sondern eine Strategie der Entpolitisierung und ein Machterhaltungsinstrument, das den status quo schützt, während es den Anschein von Fortschritt und Kooperation zwischen Entwickelten und Unterentwickelten erweckt. Vielmehr sind die Herrschenden vollständig abhängig von Verhältnissen, die auf der Zerstörung von Lebenswelten und der Ausbeutung von Menschen bestehen. Die ihnen innewohnende Logik der Kapitalakkumulation und Machtzentralisierung steht damit im fundamentalen Widerspruch zur Logik des Lebens und der Freiheit der indigenen Bevölkerung des Regenwaldes, welche die Grundlage gegenseitiger Humanisierung bildet.
Anstelle von kapitalbasierten Transaktionen, die die Lage häufig verschlimmern – denn die Bedürfnisse der im Regenwald lebenden Menschen gehen deutlich über den Einfluß des Kapitals hinaus, was in der Konsumgesellschaft als lebensnotwendig gilt -, ist der authentische Dialog als Grundbedingung für Lösungsfindung zu betrachten. Hierin liegt die zentrale Herausforderung: Eine echte Begegnung zwischen den Zerstörer:innen und Bewahrer:innen der Lebenswelt ist nur möglich, wenn die bedingungslose Anerkennung der Menschlichkeit des Anderen jenseits aller ökonomisch-basierte Machtverhältnisse vorausgesetzt wird. Ähnlich wie in Freires Kritik am „Bankiers-Konzept“ der Bildung, bei dem Lehrende Wissen in die Lernenden „einzahlen“ und so die bestehende Unterdrückung konservieren, erscheint auch die Unterstützung „von oben“ in Form von Kompensationszahlungen für Umweltzerstörung als zynischer Widerspruch. Jeder Versuch, die Macht der Unterdrücker:innen lediglich zu „mildern“, mündet fast unweigerlich in diese Form der heuchlerischen Großzügigkeit, die den status quo nicht aufbricht, sondern vielmehr verfestigt.
Das zeigt sich im CO₂-Emissionshandel: Die „Großzügigkeit“ der Unterdrücker:innen besteht in der Einräumung von Verschmutzungsrechten und der Finanzierung von Kompensationsprojekten, die jedoch stets innerhalb der Logik des bestehenden Systems bleiben. Wie Freire bemerkt, fürchten die Unterdrückenden jede echte Begegnung bzw. jede Möglichkeit eines authentischen Dialogs, die das System, das sie begünstigt, in Frage stellen würde. Die scheinbare Kompensation durch CO₂-Emissionszertifikate bewahrt somit die grundlegende unterdrückende Machtstruktur, während sie den Anschein von Fortschritt und Verantwortungsübernahme erweckt.
Das führt uns zur Umsetzung eines globalen Prinzips der „erlaubten“ Verschmutzung und Zerstörung der Lebenswelt, und daher zur Notwendigkeit einer kritischen Betrachtung des sogennanten „Emissionshandelssystems“ (Emissions Trading System). Theoretisch funktioniert das Emissionshandelssystem (ETS) über eine Obergrenze (Cap) für Treibhausgase, die Zuteilung von Zertifikaten und deren Handel (Trade).8 In der Praxis jedoch anerkennt und institutionalisiert dieses System das „Recht“ auf Verschmutzung für diejenigen, die es sich leisten können. Es zielt nicht auf Null-Emissionen, sondern auf deren Optimierung innerhalb wirtschaftlicher Grenzen.
Logikwandel
Im Kontext einer globalen Krise von unvorstellbarem Ausmaß entsprechen Maßnahmen wie die willkürliche Einführung von Kohlenstoffzertifikaten dem, was in der Sprache Freires als „antidialogisches Handeln“ bezeichnet wird, da sie das grundlegende Moment der Begegnung auf Augenhöhe zwischen den verursachenden Unternehmen und den von der Umweltkatastrophe betroffenen Völkern nicht berücksichtigen. Die Lösung der Krise kann nicht von denen kommen, die sie nicht nur verursacht haben, sondern auch von ihr profitieren und darauf ihre wachsende politische Macht stützen.
Eine kritische Analyse – wie die bereits erwähnte Recherche im kolumbianischen Guaviare – würde deutlich machen, dass die großzügige, oft kostenlose Zuteilung von Zertifikaten an energieintensive Industrien in der Anfangsphase ein direkter Erfolg des politischen Marketings ist. In diesem Sinne spielt der Lobbyismus als Architekt des Systems eine zentrale Rolle. Die politische Gestaltung der Emissionshandelssysteme wird tatsächlich durch wirtschaftliche Interessen geprägt. Es ist leicht zu beobachten, wie Branchenverbände der Schwerindustrie, Energieerzeugung und Luftfahrt seit Beginn des EU-Emissionshandelssystems erheblichen Einfluss auf dessen Ausgestaltung ausübten.9 Ihre Strategien umfassten insbesondere die Durchsetzung von Ausnahmeregelungen und verlängerten Übergangsfristen für eingestufte Branchen, sowie die Förderung von Kompensationsmechanismen (Offsetting), deren problematische Auswirkungen sich besonders in sensiblen Regionen wie dem Regenwald zeigen.10 Der Preis der Umweltverschmutzung wird in der Tat anderswo, in den Regenwäldern, bezahlt. Die scheinbare Effizienz des Zertifikatehandels im Globalen Norden wird durch die Externalisierung der wahren Kosten in die Länder des Globalen Südens erkauft. Solche Kompensationsmechanismen, die grundsätztlich die ökologischen Kosten externalisieren, werden heute als eine Form des Carbon Colonialism betrachtet.11
Am Beispiel des indigenen Volkes der Nukak in Kolumbien wird dieser Neo-Kolonialismus besonders deutlich. Eine Gruppe von Politiker:innen und Unternehmer:innen instrumentalisierte das Volk, das in extremer Verletzlichkeit lebt, um Millionen-Deals mit Kohlenstoffkrediten aus ihrem 954.000 Hektar großen Territorium zu vermitteln. Während die Mittelsmänner nach profitablen Verträgen strebten, lebte die Mehrheit der Nukak vertrieben in provisorischen Siedlungen ohne grundlegende Versorgung, teils unter Bedingungen von Prostitution und Armut. Das zentrale Projekt (Deiyiabena Redd+) scheiterte letztlich, da eine unabhängige Prüfung durch Icontec (Instituto Colombiano de Normas Técnicas) die Validierung ablehnte. Die versprochenen Millionenerträge blieben aus, und das angeblich geschützte Gebiet war gleichzeitig von massiver Entwaldung betroffen. Allein im Verwaltungsgebiet Guaviare (einem der 32 Verwaltungsgebiete oder Departamentos Kolumbiens) im nördlichen Amazonas-Gebiet wurden zwischen 2020 und 2022 rund 27.188 Hektar Wald abgeholzt – teilweise innerhalb des Nukak-Reservats-, ungefähr der Fläche der Stadt München.
Die Sprache der Klimakompensation – mit scheinbar neutralen oder wohlwollenden Begriffen wie „Entwicklungszusammenarbeit“ und „Umweltpartnerschaften“ – verschleiert oft die eigentlichen unterdrückenden Machtverhältnisse. Wie Freire erkannte, dient diese „zähmende“ Pädagogik (pedagogia domesticadora) der Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung, nicht ihrer Transformation. Sie entpolitisiert den fundamentalen Konflikt und verwandelt ihn in ein technisches Management-Problem, vor allem durch eine propagandistische mediale Manipulation in der Öffentlichkeitsphäre. Daher ist eine kritische und tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit der laufenden Ausbeutung und Verwüstung der Lebenswelt mehr denn je notwendig. Es gilt, die euphemistische Sprache zu dekonstruieren, die die Zerstörung als Geschäft und die Ausbeutung als Partnerschaft tarnt, um so den Weg für eine wahrhaft befreiende Praxis zu ebnen.
Was die historisch uterdrückten Gemeinden und Völker in Kolumbien (und in der ganzen Region) seit Jahrzehnten einfordern, ist ein echter Systemwandel, nicht die verwaltete Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen. Diese Forderung hat sich insbesondere in Lateinamerika im Laufe des 20. Jahrhunderts in einer Vielzahl von Bauern- und Indigenenbewegungen (movimientos campesinos e indígenas) materialisiert – basisdemokratische Bewegungen, die sich gleichermaßen gegen die innewohnende Nekropolitik12 des kapitalistischen Systems und dessen „Demokratie von oben“ richten. Eine Regierungsform, die private Interessen systematisch über das Gemeinwohl stellt, wird von diesen sozialen Bewegungen nicht einfach abgelehnt, sondern durch radikal alternative Vorstellungen von Demokratie und Gemeinwohl (wie z.B. Befreiungspädagogik und Buen Vivir) herausgefordert. Anstelle einer herabgereichten, verwaltenden Politik, die im Fall der Emissionszertifikate sogar die Zerstörung selbst zur Ware macht, insistieren diese Basis-Bewegungen auf der Anerkennung ihrer Autonomie, ihrer territorialen Rechte und ihrer epistemischen Perspektiven. Sie kämpfen damit nicht nur für konkrete politische Ziele, sondern führen fundamental die Unvereinbarkeit einer auf Akkumulation und Extraktion basierenden Lebensweise mit der tatsächlichen Bewahrung des Lebens vor Augen. Ihr Widerstand ist die praktische Umsetzung der Kritik an einer „falschen Großzügigkeit“ und der lebendige Beweis für die Notwendigkeit, die Logik des Kapitals nicht zu managen, sondern zu überwinden.
Die CO₂-Emissionszertifikate in ihrer aktuellen Form dienen als politisches Feigenblatt. Sie schaffen einen Anschein von Aktivität gegen die sogenannte Klimakrise, während sie die zugrundeliegenden Macht- und Wirtschaftsstrukturen unangetastet lassen und die Last der Krise auf diejenigen abwälzen, die am wenigsten zu ihr beigetragen haben. Vor dem Hintergrund, dass die Vereinten Staaten und die europeischen Länder (inkl. England) für einen großen Teil der historischen Emissionen verantwortlich sind (neben China, Saudi Arabien und Indien) 13, die die heutige Klimakatastrophe verursacht bzw. verstärkt haben, wird die Ungerechtigkeit dieses Systems besonders deutlich.
Es bedarf einer grundlegenden Abkehr von einem System, das Umweltverschmutzung lediglich verwaltet, hin zu einer Politik, die diese konsequent beendet. Dies erfordert einerseits strikte Regulierungen und Verbote für die zerstörerischsten Praktiken, so wie dezentrale, erneuerbare Energiesysteme, die lokalen Gemeinschaften zugutekommen. Andererseits setzt die Stärkung der Landrechte indigener Völker, die sich als die effektivsten Hüter der Wälder erwiesen haben,14 voraus, was eine genuine Klimagerechtigkeit, die die historische Verantwortung des Globalen Nordens anerkennt und die Interessen der Ökosysteme sowie ihrer Bewohner über die Profitinteressen einer kleinen Gruppe stellt.
Die Ökonomisierung der Umweltverschmutzung durch den CO₂-Zertifikatehandel institutionalisiert nicht nur eine zunehmend unmenschliche Wirtschaftspolitik, sondern untergräbt auch die dialogischen Grundlagen eines solidarischen Nord-Süd-Austauschs. Diese Pervertierung von Klimaschutz zu einem Geschäftsmodell fördert zudem durch strukturelle Anreize und Zwänge eine „Korrosion des Charakters“15 unter den Unterdrückten – insbesondere bei sozialen Führungspersönlichkeiten und Unternehmer:innen, die aus Eigeninteresse zum Schaden der Gemeinschaft handeln. Was als marktwirtschaftliche Lösung daherkommt, entpuppt sich so als Mechanismus, der die grundlegenden Machtverhältnisse nicht nur bestehen lässt, sondern durch die Kommodifizierung von Natur und die Schaffung neuer Profitquellen sogar verstärkt. Diese Dynamik manifestiert sich in konkreten Fällen von Korruption, in denen die ohnehin prekären sozialen Gefüge in den betroffenen Gemeinschaften zusätzlich destabilisiert werden – ein weiterer Beleg für den fundamentalen Widerspruch zwischen der Logik des Kapitals und einer wahrhaft nachhaltigen und gerechten Entwicklung.
Die Geschichte der Nukak entlarvt das paradoxe Versprechen der Umweltverschmutzung-Kompensationen, da, anstatt den Wald zu schützen und die Bewohner:innen zu stärken, der Reiz des schnellen Geldes zu Ausbeutung, innerer Spaltung und einer weiteren Schwächung einer ohnehin schon extrem verletzlichen Gemeinschaft führt. Im Geiste Freires benötigen die Nukaks keine Kompensation innerhalb eines ungerechten Systems, sondern eine befreiende Pädagogik der ökologischen Transformation weltweit, die die Stimmen der Unterdrückten in den Mittelpunkt stellt und die strukturellen Ursachen der Klimakrise benennt und bekämpft. Echte Klimagerechtigkeit erfordert nicht die Verwaltung von Verschmutzungsrechten, sondern die demokratische Transformation unserer Produktions- und Lebensweise – eine Transformation, die nicht den Interessen des Kapitals, sondern der Würde aller Menschen und Ökosysteme verpflichtet ist.
1„Colômbia: os Nukak, o último povo nômade contatado“ https://www.wrm.org.uy/pt/node/12874
2Eine Studie bei Forensic Architecture untersucht die historische „kartografische Dominanz“ des kolumbianischen Staates über das Nukak-Volk in Guaviare mittels räumlicher, bildlicher und Datenanalyse. Sie stützt sich auf jahrzehntelange Arbeit von Menschen mit lokaler Erfahrung und unterschiedlichen Wissensformen, und dokumentiert eine Konstellation umweltzerstörender Praktiken – Abholzung, Brandrodung, chemische Besprühung, Rinderzucht und zerstörerische „Entwicklung“ – zur Unterwerfung des Landes und seiner Menschen. https://forensic-architecture.org/investigation/the-forest-under-detection
3Der Film „Los Nukak Makú, los últimos nómadas verdes“ (1993) (Die Nukak Makú, die letzten grünen Nomaden) dokumentiert die traditionelle Lebensweise der Nukak Makú und zeigt gleichzeitig ihr Verschwinden durch die fortschreitende Kolonisierung des Regenwaldes. https://www.senalmemoria.co/historia-indigena-nukakmaku
4“Nukak: desterrados y ahora usados en un turbio negocio de créditos de carbono”. Diese Untersuchung liefert ein sehr konkretes und gut dokumentiertes Fallbeispiel für die Problematik. Sie zeigt, wie das System der Kohlenstoffkompensation in der Praxis anfällig für Ausbeutung, undurchsichtige Geschäfte und die Instrumentalisierung indigener Gemeinschaften ist. https://voragine.co/historias/investigacion/nukak-siguen-desterrados-y-ahora-son-usados-en-un-turbio-negocio-de-creditos-de-carbono/
5Die Recherche von César Molinares und Diego Legrand, mit Unterstützung des Stipendiums „Relatos de Región: periodismo local que explica Colombia” (Regionale Berichte: lokaler Journalismus, der Kolumbien erklärt) des Ceper der Universidad de los Andes erschien am 27. Oktober 2025.
6https://insightcrime.org/news/miraflores-peace-never-arrived/
7Vgl. Freire, P. (2023). Pedagogía del oprimido. Paz e Terra.
8https://www.epa.gov/emissions-trading/how-do-emissions-trading-programs-work
9„Die Entwicklungen im Jahr 2024 auf Ebene der Branchen gegenüber dem Vorjahr 2023 sind sehr heterogen. Während 2023 alle Branchen rückläufige Emissionen verzeichneten, nahmen die Emissionen 2024 vor allem in der Nichteisenmetallindustrie (15 %) und der chemischen Industrie (9 %) stark zu. Leichte Anstiege der Emissionen zwischen 1,5 bis knapp 3 % konnten bei den Raffinerien, der Eisen- und Stahlindustrie, Industrie- und Baukalk und der Papier- und Zellstoffindustrie verzeichnet werden. Einzig bei der Zementklinkerherstellung ist ein Rückgang um 10 % zu verzeichnen.” https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/der-europaeische-emissionshandel#teilnehmer-prinzip-und-umsetzung-des-europaischen-emissionshandels
10Die Dimension wirtschaftlicher Interessen wird deutlich, wenn man betrachtet, dass etwa 78 fossile Kraftstoffunternehmen für über 70% der globalen industriellen CO₂-Emissionen verantwortlich sind und zugleich Billionen-Gewinne erzielten, während die sozialen Kosten ihrer Emissionen in ähnlicher Höhe lagen. https://influencemap.org/briefing/The-Carbon-Majors-Database-26913
Mittlerweile erzielten die fünf großen Ölkonzerne (ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, TotalEnergies) im 2024 kombiniert über 102 Milliarden US-Dollar Gewinn. https://energy-profits.org/
11Dehm, Julia. (2016) Carbon colonialism or climate justice? Interrogating the international climate regime from a TWAIL perspective. Windsor Yearbook of Access to Justice (2016) 33.
12Während der Begriff der Nekropolitik erst viel später von Achille Mbembe eingeführt wurde, können seine Grundgedanken in den Werken von Paulo Freire und Erich Fromm antizipiert werden. In seiner „Pädagogik der Unterdrückten“ (veröffentlicht im Jahr 1968), die von Fromms humanistisch-psychoanalytischen Ideen ziemlich beeinflusst ist, entwickelt Freire eine fundamentale Kritik an Unterdrückungssystemen. Er analysiert, wie diese Systeme nicht nur die ökonomischen, sondern auch die geistigen und existenziellen Potenziale der Menschen unterdrücken und sie in einem Zustand der Dehumanisierung gefangen halten – ein Zustand, den Mbembe später als eine Form der ‚sozialen Tötung‘ oder Nekropolitik beschreiben würde. (vgl. Mbembe, Achilles. Necropolitics. 2003)
13„The 14 top carbon majors (the former Soviet Union, People’s Republic of China for coal, Saudi Aramco, Gazprom, ExxonMobil, Chevron, National Iranian Oil Company, BP, Shell, India for coal, Pemex, CHN Energy, People’s Republic of China for cement) represent 30% of the total cumulative anthropogenic CO2 emissions, including land use, about as much as the 166 other carbon majors combined (27%). From a national perspective, 33 carbon majors are headquartered in the United States, accounting for 10% of the total CO2 emissions, and 33 carbon majors are headquartered in China (12% of the total CO2 emissions).“ https://www.nature.com/articles/s41586-025-09450-9
14Zahlreiche Studien beweisen die Wirksamkeit der Konservierung von Wäldern unter Indigenen. Besonders erhellend finde ich die Studie der Vereinten Nationen Forest governance by indigenous and tribal peoples. An opportunity for climate action in Latin America and the Caribbean. „Die Regenwälder sind dort besonders gut geschützt, wo indigene Völker leben und die Verantwortung tragen. Die Rechte Indigener zu wahren und zu stärken, ist somit ein zentraler Bestandteil zum Erhalt der Wälder, der Artenvielfalt und im Kampf gegen die Klimakatastrophe.“ https://www.regenwald.org/news/10136/indigene-sind-die-besten-regenwaldschuetzer
15So wie Richard Sennett in seinem Buch „The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism“ bezeichnet.
81667 München
Nuestras Redes